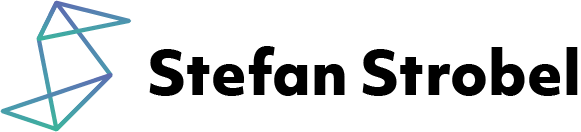Zum dritten Mal in meinem Leben erlebe ich einen technologischen Boom. Und diesmal ist er lauter denn je. Nach dem Aufstieg des Internets und der Verbreitung mobiler Devices zieht nun die Künstliche Intelligenz in unser aller Leben ein. Und das nicht nur im beruflichen Kontext.
Das Thema ist keineswegs neu. Bereits vor über 70 Jahren entstanden, z.B. durch Alan Turing, wissenschaftliche Arbeiten zur KI. Und auch in meinem Studium Ende der 80er war das ein Thema. Was heute jedoch anders ist, ist die Schnelligkeit und Tiefe, mit der KI Einzug hält. Möglich wird das auch durch neue technologische Sprünge und massenverfügbare Rechenleistung.
Was mich dabei umtreibt: Die Meinungen gehen weit auseinander.
Da sind einerseits Zukunftsgurus, die das Ende der menschlichen Arbeitskraft verkünden. Und andererseits KI-Skeptiker, die in dystopischen Szenarien vor Kontrollverlust und gesellschaftlichem Kollaps warnen. Die Debatte ist laut, polarisiert und oft wenig differenziert.
Ich glaube: Der Nutzen liegt wie so oft in der Mitte.
Deshalb habe ich begonnen, mich dieser Mitte anzunähern. Mit Fragen statt mit schnellen Antworten:
Was bedeutet eigentlich „intelligent“?
Was ist ein intelligenter Mensch?
Bisher wurde Intelligenz oft an mentalen Leistungen oder wirtschaftlichem Erfolg gemessen. Doch muss das so bleiben?
Könnten nicht auch andere Maßstäbe zählen, wie persönliche Reife, emotionale Klarheit oder der Beitrag zum Gemeinwohl? Wenn wir KI als „intelligent“ bezeichnen, dann stellt sich doch genau diese Frage: Welche Art von Intelligenz meinen wir eigentlich?
Wo beginnt Verantwortung und wo geben wir sie ab?
In Zeiten von Automatisierung und Delegation ist diese Frage zentral.
An welchen Stellen sollten wir Menschen die Verantwortung unbedingt behalten? Und an welchen geben wir sie oft fast beiläufig an Algorithmen, Systeme oder Dritte ab? Was macht das mit unserem Gefühl von Kontrolle, Mitgestaltung und Selbstwirksamkeit?
Wer gestaltet denn die Zukunft?
Möchten wir unsere Zukunft einigen wenigen Tech-Giganten überlassen?
Wollen wir sie aktiv mitgestalten oder nur reagieren?
Die Frage „In welcher Zukunft möchtest du leben?“ höre ich oft. Ich würde sie gerne erweitern: In welcher Zukunft möchte ein heutiges Kind oder Jugendlicher leben? Diese Perspektive verschiebt den Fokus – weg vom kurzfristigen Nutzen, hin zu langfristiger Verantwortung.
Quanten & KI – was liegt noch vor uns?
Seit Beginn der IT haben sich Software- und Hardwareentwicklung gegenseitig beschleunigt. Viele Engpässe in der Softwareleistung wurden durch neue Chips quasi nebenbei gelöst.
Was passiert, wenn sich in den nächsten fünf oder zehn Jahren Quantencomputing und KI sowie Robotik miteinander verbinden?
Ich vermute: Die wenigsten von uns können sich heute ausmalen, welches Potenzial, aber auch welche Risiken dann vor uns liegen.
Die Chance: Mehr Mensch statt weniger
Trotz aller Herausforderungen bin ich überzeugt: KI kann uns entlasten.
Sie kann monotone, wiederkehrende oder schlichtweg langweilige Tätigkeiten übernehmen und so Freiraum schaffen für das, was zutiefst menschlich ist: Beziehung, Kreativität, Intuition, echte Begegnung.
Individuelle Vorteile wie Zeitgewinn, Effizienz oder Kostenersparnis sind wertvoll. Aber nur dann, wenn sie nicht nur der Optimierung dienen, sondern auch Raum für Leben eröffnen.
Denn so technologisch durchdrungen unsere Gesellschaft auch wird: Wir bleiben Menschen. Und wir sind, ob wir wollen oder nicht, die Rahmengeber und Möglichmacher dieser Entwicklungen.
Wir sind mehr als Systeme, mehr als Algorithmen und auch mehr als Nullen und Einsen.
Wir sind diejenigen, die entscheiden, wie wir mit KI umgehen.
Und das ist für mich eine zutiefst menschliche Aufgabe.